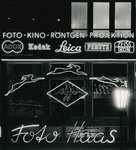Yes, keep me informed about new issues! Please send me your newsletter, even though it is in German.
Bücher, kurz vorgestellt
Erschienen in: Fotogeschichte 109, 2008
- Marion Beckers, Elisabeth Moortgat (für Das Verborgene Museum e.V.): Die Riess. Fotografisches Atelier und Salon in Berlin 1918–1932 – Berlin: Das Verborgene Museum, 2008 – Mit Beiträgen (dt./engl.) der Herausgeberinnen sowie von Thomas Ehrsam, Ottfried Drascher, Peter Sprengel und Karin Wieland – Katalog zur gleichnamigen Ausstellung in der Berlinischen Galerie, Berlin, 6. Juni bis 20. Oktober 2008 – 28,5 x 23,5 cm, 256 S., 225 Abb. in Duoton, gebunden – 39,80 Euro
Die (lange gesuchte und schließlich gefundene) Geburtsurkunde, ein handgeschriebener Brief aus dem Jahr 1915 und der Katalog einer Ausstellung aus dem Jahr 1925, das sind die wenigen lebensgeschichtlichen Zeugnisse, die die Jahre überdauert haben. Aus diesem schmalen dokumentarischen Gerüst und zahlreichen Recherchen im biografischen und gesellschaftlichen Umfeld der Fotografin Frieda Riess (geb. 1890) haben die Berliner Fotohistorikerinnen Marion Beckers und Elisabeth Moortgat eine spannende und kenntnisreiche Biografie der Fotografin erarbeitet. Und zugleich spiegelt sich im Porträt dieser Frau ein weniger bekanntes Stück der Weimarer Republik. So kann man Fotogeschichte schreiben, so sollte man sie schreiben. Ein wunderbares Buch!
- Geoffrey Batchen: William Henry Fox Talbot – London, New York: Phaidon, 2008 – 27,2 x 21,8 cm, 128 S., 56 Abb. in Farbe, gebunden – 29,95 Euro
Zu Talbot ist fast alles gesagt. Und dennoch ein neues Buch über den englischen Fotopionier? Batchen, durch sein Standardwerk Burning with Desire. The Conception of Photography (erste Auflage 1997) als ausgewiesener Kenner der frühen Fotografie international bekannt, bietet keine neuen Forschungsergebnisse, aber dafür eine gute Einführung an. Den Hauptteil des Bandes bilden (durchaus auch weniger bekannte) hervorragend und in Farbe gedruckte Aufnahmen, die, ergänzt durch kurze, informative Kommentare, in die wissenschaftliche und ästhetische Welt dieses Gelehrten einführen.
- Robert Frank: Die Amerikaner. Aus dem Englischen von Hand Wolf. Mit einer Einführung von Jack Kerouac – Göttingen: Steidl, 2008 – 21 x 18,4 cm, 83 Tafeln in Tritone, gebunden mit Schutzumschlag – 30 Euro
Robert Franks Die Amerikaner wurde zuerst, 1958, unter dem Titel Les Américains im Pariser Verlag von Robert Delpire veröffentlicht. Ein Jahr später erschien bei Grove Press in New York eine amerikanische Ausgabe. Die Einleitung steuerte Jack Kerouac bei. In den 1970er Jahren erlangte das Buch Kultstatus, seither ist es in zahlreichen Sprachen immer wieder aufgelegt worden. Der Steidl Verlag hat sich nun – zusammen mit dem heute knapp 85jährigen Fotografen – zu einer Neuausgabe entschlossen. Neu ist wenig, eine etwas adaptierte Typografie, durchwegs neue Scans und zwei Motivvarianten. Das ist alles. Man hätte sich zumindest ein Nachwort erwartet, das die erstaunliche Karriere dieses Buches nachzeichnet. Der Band erscheint in Deutsch, Englisch und –Chinesisch. Warum aber nicht in Französisch?
- Robert Frank: Paris. Mit einem Gespräch zwischen Robert Frank und Ute Eskildsen – Göttingen: Steidl, 2008 – 22,5 x 19 cm, 160 S., 80 Tafeln in Tritone, gebunden mit Schutzumschlag – 30 Euro
„Ich habe“, erinnert sich Robert Frank, „in Paris versucht, durch meine eigene Arbeit das Interesse von Zeitungen zu finden oder von Illustrierten, aber da war nichts zu machen.“ Über 50 Jahre später ist das Interesse an Franks Paris-Bildern da. Unter der Leitung von Ute Eskildsen (Fotografie) und Laura Israel (Film) bringt der Steidl Verlag in den nächsten Jahren (bis 2010) eine Robert Frank-Gesamtausgabe heraus: Bildbände, Reprints weniger bekannter Arbeiten, aber auch neu zusammengestellte Fotobücher (wie eben den Paris-Band) und natürlich alle Filme – in insgesamt zehn Lieferungen. Ein ambitioniertes Projekt.
- Blicke und Begehren. Der Fotograf Herbert Tobias 1924–1982, hg. von Ulrich Domröse – Göttingen: Steidl, 2008 – Mit Texten von Ulrich Domröse, Janos Frecot, Anna-Carola Krausse, Pali Meller-Marcovicz, Adelheid Rasche, Andreas Sternweiler, Ingo Taubhorn und Ulf Erdmann Ziegler – Katalog zur gleichnamigen Ausstellung in der Berlinischen Galerie 16. Mai – 25. August 2008 und im Haus der Fotografie, Hamburg, 30. April bis 30. August 2009 – 27 x 23 cm, 272 S., 240 Abb. in Tritone, gebunden mit Schutzumschlag – 35 Euro
1982 starb der deutsche Fotograf Herbert Tobias im Alter von 57 Jahren an Aids. Zu diesem Zeitpunkt war er als Fotograf fast in Vergessenheit geraten. Seine große Zeit als Mode- und Glamourfotograf waren die 1950er und 60er Jahre gewesen. Ulrich Domröse, der Katalog und Ausstellung initiierte, ist die Wiederentdeckung dieses exzentrischen Fotografen zu verdanken. Neben Auftragsarbeiten hat Tobias ein spannendes, vielschichtiges Werk hinterlassen, u.a. mit eindrucksvollen Porträts, Straßen- und Stadtaufnahmen. Wie immer bei Steidl: hervorragend gestaltet und gedruckt.
- Galerie Daniel Blau (Hg.): Gegossenes Licht – Cast Light. Skulptur in der Photographie 1845–1860 – München: Galerie Daniel Blau, 2008 – Katalog zur gleichnamigen Ausstellung in der Galerie Daniel Blau, München, 27. Juni bis 30. Juli 2008 – 29 x 24 cm, 100 S., zahlreiche Abb. in Farbe, gebunden (Leinen) – 58 Euro, Bestellung: contact@danielblau.com
Ein wunderbares, von der Fotografiegeschichte meist nur gestreiftes Thema ist die Skulptur in der frühen Fotografie. Der Katalog präsentiert, hervorragend und in Farbe gedruckt, faszinierende Beispiele der Fotografie auf Papier, vorwiegend aus dem französischen und italienischen Raum sowie aus dem Orient. Schade, dass der Band bis auf die Bildbeschriftungen keine eingehende Texteinführung bietet. Für die weitere wissenschaftliche Beschäftigung ist das Buch leider ein Torso.
- Graue Donau, Schwarzes Meer. Wien, Sulina, Odessa, Jalta, Istanbul, hg. von Christian Reeder und Erich Klein – Wien: Springer Verlag, 2008 – 588 S., zahlreiche Abb. in S/W und Farbe, kartoniert – 39,95 Euro
Eine vielschichtige, mäandrierende Donaureise – auf den Spuren der Geschichte, der Politik, der Kunst, mit unerwarteten Begegnungen, vermittelt in kürzeren Reiseskizzen und -berichten. Das Katalogbuch von Christian Reeder und Erich Klein ist kein Fotoband, und doch spielt die Fotografie darin eine wichtige Rolle. Vom Interview mit dem Magnum-Fotografen Erich Lessing über die Fotodokumentationen von Bodo Haas bis zur fotofilmischen Donaureise Michael Auschauers. Wunderbar gestaltet von Stefan Fuhrer, aber leider ohne ein thematisches Register.
- Pigozzi and the Paparazzi: Salomon, Weegee, Galella, Angeli, Secchiaroli, Quinn, Newton – Berlin: Helmut Newton Foundation, 2008 – Katalog zur gleichnamigen Ausstellung in der Helmut Newton Foundation, Berlin, 19. Juni bis 16. November 2008 – Mit einem Beitrag von Matthias Harder – 34 x 25 cm, 76 S., zahlreiche Abb. in S/W – 7 Euro
1970 reiste Helmut Newton nach Rom, um für die italienische Zeitschrift Linea Italina mit „echten“ Paparazzi zusammenzuarbeiten. Sie sollten gemeinsam mit seinen Modellen posieren. Ausgehend von Newtons Faszination für fotografische Grenzüberschreitungen lotet die Ausstellung – wie betont wird, erstmals im deutschen Sprachraum – die Geschichte der Paparazzi-Fotografie aus. Das Ergebnis ist kläglich – ein wild zusammengewürfeltes Bildpotpuorri, ein liebloses Heftchen als „Katalog“, ein Einleitungstext von Matthias Harder, der sich mit allerlei Banalitäten zufrieden gibt.
- Christine Brocks: Die bunte Welt des Krieges. Bildpostkarten aus dem Ersten Weltkrieg 1914–1918 – Essen: Klartext Verlag, 2008 – 294 S., zahlreiche Abb. in S/W, kartoniert – 29,95 Euro
„Bislang dienten Bildpostkarten, die einen wichtigen Bereich der populären Kultur darstellen, (…) vor allem als Illustrationen, als Beispiele für die ‚gute alte Zeit’ (…) oder konträr dazu als Beleg für die Propaganda von Militär und Staat im Ersten Weltkrieg“, konstatiert die Autorin und belegt eindrucksvoll, dass Bildpostkarten weit mehr über die visuelle Verarbeitung des Krieges zeigen können. In ihnen lassen sich Feind- und Fremdstereotype analysieren, Karten waren ein wichtiges Medium der Eingewöhnung von Gewalt, Folien für Rollen- und Geschlechterverhältnisse und sie ermöglichten es, Zerstörungen in touristische Ansichten zu kleiden. Schade, dass auf die Qualität der (leider wenigen) Abbildungen so wenig Wert gelegt wurde.
- Helen Bömelburg: Der Arzt und sein Modell. Porträtfotografien aus der deutschen Psychiatrie 1880 bis 1933 – Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2007 – 288 S., 68 Abb. in S/W, kartoniert – 38 Euro
„Der fotografische Blick der Ärzte richtete sich auf den Körper und ins Gesicht des psychisch Kranken. Denn hier, so meinten die Mediziner, würden psychische Erkrankungen sichtbar.“ So schreibt die Autorin in der Einleitung. Die als Dissertation eingereichte Forschungsarbeit beschäftigt sich mit den Fotosammlungen der psychiatrischen Universitätsklinken in Hamburg, Giessen und die Sammlung einer Heil- und Pflegeanstalt in Göppingen. Sie betritt von Material und Thema her spannendes Neuland in der Fotogeschichte.