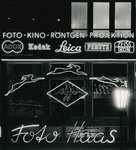BÜCHER, KURZ VORGESTELLT
Erschienen in: Fotogeschichte, Heft 137, 2015
- Nickolaus Muray: Double Exposure, hg. von Christian Philipsen, München: Hirmer Verlag, 2015, Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im Kunstmuseum Moritzburg, Halle (Saale), 1. März bis 10. Mai 2015, 303 S., 28 x 24 cm, zahlreiche Abb. in S/W und Farbe, gebunden, 39,90 Euro
Das fotografische Werk von Nickolaus Muray (1892–1965), der als Miklos Mandl in Szeged, Ungarn, geboren wurde, ist in Europa eine veritable Entdeckung. Mandl ging mit 16 Jahren nach München und später Berlin, um zu studieren, anschließend arbeitete er zwei Jahre lang als Fotograveur im Ullstein Verlag. 1913 zog er nach New York. Er arbeitete zunächst weiterhin als Fotograveur und begann nebenbei zu fotografieren. Bald folgten Aufträge bekannter Mode- und Gesellschaftsmagazine. Mitte der 1920er Jahre gehörte er bereits zu den gefragtesten Porträt-, Tanz-, Werbe- und Modefotografen der Stadt. Anfang der 1930er Jahre wurde er zu einem Pionier der amerikanischen Farbfotografie.
- Margot Blank, Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst (Hg.): Propaganda-Fotograf im Zweiten Weltkrieg: Benno Wundshammer, Berlin: Ch. Links Verlag, 2014, Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im Deutsch-Russischen Museum Karlshorst, 12. November 2014 bis 15. Februar 2015, 120 S., 27 x 22 cm, kartoniert, 14,90 Euro
Die Fotokuratorin des Deutsch-Russischen Museums Berlin-Karlshorst, Margot Blank, hat sich einen Namen in der Erforschung und Edition sowjetischer Kriegsfotografen (zuletzt schrieb sie in einem Heft der Fotogeschichte auch zum Thema Kriegsfotografinnen) gemacht. Nun hat sie die Aufarbeitung der Fotobestände des bekannten deutschen Kriegsfotografen im Zweiten Weltkrieg, Benno Wundshammer (1913–1986), betreut. Ausgehend vom vollständig erhaltenen, umfangreichen Nachlass im Archiv der Bildagentur bpk der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, wird anhand zahlreicher Bilder seine fotografische Karriere nachgezeichnet. Diese führte ihn vom Lokalreporter in Köln zum umjubelten Propagandafotografen der Wehrmacht. Nach 1945 trat er recht bruchlos in die bundesrepublikanische Zeitschriftenszene ein.
- Lionel Gossman: Thomas Annan of Glasgow. Pionier of documentary photography, Cambridge: OpenBook Publishers, 2015, 192 S., 23,4 x 15,6 cm, 140 Abb. in S/W und Farbe, kartoniert: ISBN 987-1-78374-127-4: 17,97 engl. Pfund; gebunden: ISBN 987-1-78374-128-1: 32,95 engl. Pfund, E-book: ISBN 987-1-78374-129-8: 5,95 engl. Pfund (http://www.openbookpublishers.com)
Der schottische Fotograf Thomas Annan (1829–1887) ist mit seinen Aufnahmen aus den Glasgower Slums unmittelbar vor deren Abriss 1866 als Pionier der dokumentarischen Fotografie in der internationalen Fotogeschichte bekannt geworden. Weniger bekannt ist, dass Annan auch als Landschafts- und Porträtfotograf und im Bereich der Kunstreproduktion tätig war. Gossmann, der aus Glasgow stammt und an der Princeton University als Literaturprofessor tätig war, bietet eine gute Einführung in Annans Gesamtwerk und untersucht auch dessen fotografisches Umfeld: die frühe Blütezeit der Fotografie im Viktorianischen Schottland.
- Tanya Sheehan, Andrés Mario Zervigón (Hg.): Photography and its Origins, London: Routledge 2015, 238 S., 23 x 15,5 cm, zahlreiche Abb. in Farbe und S/W, kartoniert: ISBN 978-0-415-72290-2: 39,95 Dollar, gebunden: ISBN 978-0-415-72289-6: 130 Dollar
In letzter Zeit häufen sich Studien, die der Entstehungs- und Frühgeschichte der Fotografie größeren Platz einräumen. Der Band, herausgegeben von zwei bekannten amerikanischen Fotohistorikern der jüngeren Generation, entstand ausgehend von einer Tagung im Jahr 2012 an der Rutgers University, New Jersey. Bemerkenswert und erfreulich ist, dass der Band die übliche geografische Fokussierung auf Frankreich, England und die USA stellenweise durchbricht. So finden auch die frühe chinesische (Beitrag von Yi Gu), afrikanische (Beitrag von Jürg Schneider, Basel) und am Beispiel des weniger bekannten Bertoloni-Albums mit frühen Aufnahme von Fox Talbot auch die frühe italienische Fotografie (Beitrag von Beth Saunders) Beachtung. Eine ausgezeichnete Literaturliste und ein Index runden den sehr brauchbaren Band ab.
- Anja Niedringhaus: At war, hg. von Reto Francioni und Anne-Marie Beckmann, Berlin: Hatje Cantz, 2014, 180 S., 21 x 30,5 cm, zahlreiche Abb. in Duoton, gebunden, 34 Euro.
Die Idee zu diesem Buch, erzählt die international bekannte deutsche Fotografin in einer einleitenden Notiz, entstand 2009 in ihrer Wohnung im hessischen Kaufungen, bei einem Teller Tomatensuppe. 2012 erschien die erste Auflage des Bandes, die im Herbst/Winter 2011 eine Ausstellung in Berlin (C/O Berlin) begleitete. Gut drei Jahre später, am 4. April 2014 wurde Niedringhaus in Banda Khel, Afghanistan, von einem Polizisten erschossen, der eigentlich für den Schutz der Journalisten bei der Wahlvorberichterstattung abgestellt war. Mit dieser Neuauflage des Bandes, der einen Querschnitt durch das fotografische Werk der Reporterin zeigt, wird an die beeindruckende Fotografin erinnert.
- Walter Moser, Klaus-Albrecht Schroeder (Hg.): Lee Miller, Hatje Cantz: Berlin 2015, Katalog (dt./engl.) zur gleichnamigen Ausstellung in der Albertina Wien, 8. Mai bis 16. August 2015, Museum Fort Lauderdale, 4. Oktober bis 17. Januar 2016, 160 S., zahlreiche Abb. in S/W und Farbe, broschiert, 29,80 Euro
Die Fotografin Lee Miller (1907–1977) hätte sich keinen engagierteren Öffentlichkeitsarbeiter wünschen können als ihren Sohn Anthony Penrose, geb. 1947. Dieser betreibt seit etwa 15 Jahren im ehemaligen Wohnhaus der Fotografin in Chiddingly, East Sussex, ein Art Lee Miller-Zentrum. Teil der Einrichtung sind die aus mehreren zehntausend Bildern bestehenden Lee Miller Archives, ein Museum und eine Galerie. Er hat mehrere Publikationen über seine Mutter herausgegeben und viele weitere initiiert. Der vorliegende Katalog, der in enger Zusammenarbeit mit Penrose entstand, stellt das Gesamtwerk Millers dar, kann aber auf 160 Seiten nicht mehr leisten als einen Überblicke zu bieten, das Bild der Kriegsfotografin etwa wird gegenüber der bestehenden Publikation von Katharina Menzel-Ahr: Lee Miller. Kriegskorrespondentin für Vogue (2005) kaum erweitert.
- Nikolaus Walter: Begegnungen, hg. von Petra Zudrell im Auftrag von vorarlberg museum und Vorarlberger Landesbibliothek, Heidelberg: Kehrer Verlag, 2015, 224 S., 30 x 22,5 cm, zahlreiche Abb. in Duoton, gebunden, 44,90 Euro
Anlässlich seines 70. Geburtstags vermachte der österreichische Fotograf Nikolaus Walter, geb. 1945, sein gesamtes, aus tausenden Abzügen und Negativen bestehende Fotoarchiv der Vorarlberger Landesbibliothek. Der Katalog, der anlässlich einer großen, zweiteiligen Retrospektive im vorarlberg museum und in der Vorarlberger Landesbibliothek erschien, zeigt die Anfänge des Fotografen im Wien der 60er Jahre, seine zahlreichen Reisen sowie sein beeindruckendes sozialdokumentarisches Werk, das ihn häufig an die sozialen Ränder seiner Umgebung führte. Mit Nikolaus Walter ist ein Fotograf zu entdecken, der trotz seines unbestechlichen Blicks für die menschlichen Schattenseiten auch den Humor nicht verlernt hat.
- E.O. Hoppé: The German Work 1925–1938, hg. von Phillip Prodger, Göttingen: Steidl, 2015, 240 S., 27 x 29,5 cm, 194 Abb., gebunden, 58 Euro
Der enorme kommerzielle Erfolg des deutsch-englischen Fotografen E.O. Hoppé (1878–1972) verdankte sich zeitlebens zu einem nicht geringen Teil seinen auflagenstarken Fotobildbänden, die seit Mitte der 1920er Jahre erschienen. Auch in Deutschland war er mit Fotobüchern vertreten, Romantik der Kleinstadt kam 1929 im Münchner Bruckmann Verlag heraus,Deutsche Arbeit 1930 im Berliner Ullstein Verlag. Der englischsprachige Band German Work bietet nun einen Querschnitt durch das fotografische Werk Hoppés zwischen 1925 und 1938 in Deutschland. Seine Ästhetik pendelt zwischen modernen, neusachlich inspirierten Industrieaufnahmen und heimattümelnden Kleinstadtbildern. Der aufkommende Nationalsozialismus schimmert nur am Rande durch, die politische Wende 1933 hat den Fotografen keineswegs von weiteren Besuchen im „Reich“ abgehalten.
- Sabine Schmid: Fotografie zwischen Politik und Bild. Entwicklungen der Fotografie in der DDR, München: Herbert Utz Verlag, 2014, 369 S., 20,5 x 14,5 cm, zahlreiche Abb. in S/W, kartoniert, 42 Euro
Wer sich für die Fotogeschichte der DDR interessiert, wird an diesem Band kaum vorbeikommen. In dichter Form dokumentiert die Autorin die institutionellen Rahmenbedingungen und Kontrollmechanismen unter denen die DDR-Fotografen arbeiteten. Im zweiten Teil werden beispielhaft unterschiedliche fotografische Stränge vorgestellt. Ein umfangreicher Anhang bietet ein ausführliches Literaturverzeichnis sowie eine Auflistung weiterer Quellen (Vorträge, Filme etc.). Das Buch geht auf die 2012 fertiggestellte Münchner Dissertation der Autorin zurück. Schade, dass diese in ein viel zu kleines Buchformat mit winziger Schrift gepresst wurde und dass die Bilder im Anhang etwas verloren wirken.
- Eva Tropper, Timm Starl (Hg.): Format Postkarte. Illustrierte Korrespondenzen 1900 bis 1936, hg. vom Photoinstitut Bonartes, Wien, Wien: new academic press, 2014, 148 S., 21,5 x 21 cm, zahlreiche Abb. in Farbe und S/W, broschiert, 24,90 Euro
Lange Zeit galten Postkarten als liebenswürdige Sammlerobjekte, zugleich waren sie unscheinbare Massenprodukte, für die sich die Fotografiegeschichte, die gern an wertvollen Stücken arbeitet, oft zu gut war. Das hat sich in den letzten Jahren geändert, nicht zuletzt durch die Beiträge von Eva Tropper und Timm Starl, die dem Medium Postkarte zuletzt mehrere fundierte Studien gewidmet haben. Das vorliegende Buch ist aus einem zweijährigen Forschungsprojekt hervorgegangen und bietet eine gute Einführung zur Bildpostkarte als frühem Massenmedium des 20. Jahrhunderts. Mit Texten von Eva Tropper, Timm Starl, Michael Ponstingl und Monika Faber.
- Timm Starl, Eva Tropper: Identifizieren und Datieren von illustrierten Postkarten. Mit einem Beitrag von Herbert Nessler, Wien: Photoinstitut Bonartes, Wien: new academic Press, 2014, 204 S., 29,5 x 21 cm, zahlreiche Abb. in S/W, kartoniert, 34,90 Euro
„Die vorliegende Publikation will – in einer möglichst breiten und grundlegenden Weise – Personen aus Wissenschaft und Forschung, aus Sammlungen, Archiven und Museen sowie andere am Thema interessierte mit einem Instrumentarium für die historische Einordnung illustrierter Postkarten ausstatten, wobei Bild-, Schrift- und Postdimension des Mediums gleichermaßen ernst und wichtig genommen werden.“ (Aus dem Vorwort). Bewusst wurde die Publikation in einer Kleinauflage im Digitaldruck hergestellt, damit eine kostengünstige Neuauflage möglich wird. Hilfreich wäre ein guter Index gewesen.
- Nina Klöpper: Fotografische Objekte in Schwarzweiß. Neusachliche Bildtraditionen 1920 bis heute, Berlin: Reimer Verlag, 2014, 286 S., 24,4 x 17,4 cm, zahlreiche Abb. in S/W und Farbe, 49 Euro
Die aus der Dissertation der Autorin hervorgegangene Studie untersucht anhand zahlreicher Beispiele (von Karl Blossfeldt bis Hiroshi Sugimoto, von Alfredt Ehrhardt bis Claudia Fährenkemper) die Ästhetik der neusachlichen Fotografie im 20. Jahrhundert. Die teils sehr akademisch gehaltene Reise durch die schwarzweiße Sachfotografie ist im Grunde eine Kompilation oft weit verstreuter Einsichten mit zahlreichen oft ermüdenden Exkursen. Als originelle Analyse vermag sie nicht wirklich zu überzeugen.
- Erhard Finger: In Farbe. Die Agfa-ORWO-Farbfotografie, Berlin, Hildesheim, Luzern: Frühwerk-Verlag, 2014, 252 S., 23, 5 x 16,5 cm, zahlreiche Abb. in Farbe und S/W, broschiert, 24,90 Euro
Der Autor, der als Chemieingenieur lange Zeit in der Filmfabrik Wolfen tätig war, hat sich in zahlreichen Publikation mit der Industriegeschichte Wolfens und diversen film- und fototechnischen Entwicklungen beschäftigt. In der vorliegende Publikation rekonstruiert er die Geschichte und Vorgeschichte des Agfa-Farbfilms, der ab 1936 Farbaufnahmen für die breite Bevölkerung ermöglichte und der nach 1945 unter dem Namen ORWOCOLOR zum kommerziellen Erfolg wurde. Das Augenmerk des Autors ist sehr stark auf die wissenschaftlich-technischen Aspekte gerichtet, die kultur- und zeithistorischen Hintergründe, aber auch die Ästhetik und die Rezeption der Farbfotografie bleiben unterbelichtet.
- Ilka Becker, Bettina Lockemann, Astrid Köhler, Ann Kristin Krahn, Linda Sandrock (Hg.): Fotografisches Handeln. Das fotografische Dispositiv, Bd. 1, Marburg: Jonas Verlag, 2015, 304 S., 24 x 17 cm, zahlreiche Abb., kartoniert, 33 Euro
„Die Beiträge dieses Bandes reflektieren das Fotografische in Bezug auf Praktiken und Diskurse der Handlungsfähigkeit bzw. der Handlungsinitiative. In dieser Perspektive kommen nicht nur fotografische Bilder und Apparaturen ins Spiel. Auch medienübergreifende Formen, das Reden und Schreiben über sie, ihre Rezeption und ihre Gebrauchsweisen sind Teil des fotografischen Handelns.“ (Aus der Ankündigung). Mit Beiträgen von Ilka Becker, Ulrike Bergermann, Kerstin Brandes, Florian Ebner, Hilde Van Gelder, Lilian Haberer, Susanne Holschbach, Bettina Lockemann, Astrid Köhler, Ann Kristin Krahn, Marco Poloni, Linda Sandrock, Jens Schröter und Alexander Streitberger.
- Herbert Justink (Hg.): Gestellt. Fotografie als Werkzeug in der Habsburgermonarchie, Wien: Löcker Verlag, 2014, Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im Österreichischen Museum für Volkskunde, 30. April bis 30 November 2014, 192 S., 28 x 21 cm, zahlreiche Abb. in Farbe und S/W, kartoniert, 28,80 Euro
Das Österreichische Museum für Volkskunde in Wien besitzt eine herausragende Fotosammlung, die, den Interessen der frühen Ethnologen in der k.u.k. Monarchie entsprechend, Bilddokumente aus zahlreichen Gebieten Mittel- und Südosteuropas umfasst. Der Fotokurator des Museums, Herbert Justink, hat aus diesem reichen Fundus eine umfassende, überaus anregende Ausstellung zusammengestellt, die die Konstruktion ethnologischer Fotodokumente analysiert und kritisch hinterfragt. Der Katalog bietet einen Einblick in die Fotosammlung und ihre Entstehungsgeschichte. Mit Texten von Herbert Justink, Reinhard Blumauer, Michael Ponstingl, Johannes Feichtinger, Johann Heiss und Ulrike Kammerhofer-Aggermann.
- Cornelia Kemp (Hg.): Unikat, Index, Quelle. Erkundungen zum Negativ in Fotografie und Film, Göttingen: Wallstein Verlag, München: Deutsches Museum, 2015, 261 S., 24 x 16,5 cm, zahlreiche Abb. in Farbe und S/W, broschiert, 29,90 Euro
Im goldenen Zeitalter des Vintage Print gelten Negative gelten oft als die weniger bekannten, weniger wichtigen Schattenbilder der Fotografie. Der von der Foto- und Filmkuratorin am Deutschen Museum in München mustergültig zusammengestellte, überaus interessante Sammelband korrigiert diese Haltung, indem er das faszinierende Untersuchungsfeld „Negativ“ von vielen Seiten her aufrollt. Das Buch geht auf eine Tagung im Frühjahr 2013 am Deutschen Museum zurück, die am Ende eines dreijährigen Forschungsprojekts zu den Glasnegativen des deutsch-amerikanischen Kunstfotografen Frank Eugene stattfand. Mit Beiträgen von Cornelia Kemp, Larry J. Schaaf, Mark Ostermann, Dorothea Peters, Dagmar Keultjes, Marjen Schmidt, Rolf Sachsse, Floris M. Neusüss, Vera Dünkel, Jochen Hennig und Martin Koerber.