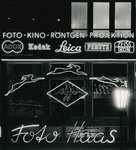Anton Holzer
Roma und Sinti darstellen
Fotografische Konstruktionen in Zeitungen und Zeitschriften der Zwischenkriegszeit 1918–1939/40
Forschungsprojekt am Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien; Leitung: Dr. Anton Holzer; Wissenschaftliche Begleitung: Prof. Dr. Alexa Färber; Förderung:
Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) – Projektnummer: 10.55776/PAT9468524; Laufzeit: 2025 bis 2029.
Dieser Beitrag ist als PDF frei zugänglich über die Projektwebsite Representing Roma and Sinti.
Erschienen in: Fotogeschichte, Heft 177, 2025
Rom*nja und Sinti*zze in der Öffentlichkeit – ein fotografischer Hype
In der Zwischenkriegszeit erlebte die fotografische Darstellung von Rom*nja und Sinti*zze[1] in der Öffentlichkeit einen enormen Aufschwung, ja man kann geradezu von einem fotografischen Hype sprechen. Nie zuvor und (bis in die digitale Ära) auch nie danach wurden europaweit derart viele Fotografien der Minderheit verbreitet wie in diesen Jahren. Präsentiert wurden die Bilder hauptsächlich in gedruckter Form: Zahlreiche illustrierte Zeitungen und Zeitschriften veröffentlichten zwischen 1919 und 1939/40 fotografische Bildberichte und Reportagen über Rom*nja und Sinti*zze. Diese teils in sehr hohen Auflagen erscheinenden Bilder und Texte trugen wesentlich dazu bei, die Images der Minderheit für eine breite Leser*innenschaft öffentlichkeitswirksam aufzubereiten und langfristig in der kollektiven Wahrnehmung zu verankern. Das enorme Interesse der gedruckten Bildmedien an der Darstellung der meist als „anders“ und exotisch dargestellten Lebensweisen von Rom*nja und Sinti*zze entstand vor dem Hintergrund tiefgreifender sozialer Umbrüche und Krisen, die in der Zwischenkriegszeit in vielen europäischen Ländern zu spüren waren. Dazu gehörten die sozialen und politischen Folgen des Ersten Weltkriegs, die Wirtschafts- und Finanzkrise, die viele Länder nach 1929 hart traf, die steigende Arbeitslosigkeit und der Aufstieg populistischer, revanchistischer und rassistischer Parteien und Bewegungen in einer Reihe von Ländern. Die Bilder über Rom*nja und Sinti*zze wurden je nach Medium und politisch-gesellschaftlicher Perspektive in sehr unterschiedlichen Kontexten und Zusammenhängen veröffentlicht. Gemeinsam aber ist vielen dieser Bildberichte, dass sie implizit oder explizit dazu beitrugen, die imaginären Außengrenzen einer verunsicherten Gesellschaft abzustecken und zu abzusichern.[2] Die Mitglieder der Rom*nja und Sinti*zze wurden häufig als die gesellschaftlich „Anderen“ einem kollektiven „Wir“ gegenübergestellt. Die Fotoreisen, aus denen viele der in den Zeitungen veröffentlichten Bildberichte hervorgingen, wurden nicht selten – und durchaus in Anlehnung an koloniale Unternehmungen – als visuelle „Expeditionen“ an die „fremden“ Ränder der „eigenen“ bürgerlichen Welt dargestellt.[3]
Bedeutsam für den großen öffentlichen Raum, den die Fotoberichte über Rom*nja und Sinti*zze in der Presse einnahmen, waren aber nicht nur die gesellschaftspolitischen Hintergründe und Krisen, sondern in hohem Maße auch tiefgreifende medienpolitische Umschichtungen und Veränderungen, die in der Zwischenkriegszeit u.a. auch zu neuen Formen der Bildberichterstattung und der visuellen Argumentation geführt haben. Dazu zählen neben der generellen Zunahme der Bedeutung von fotografisch illustrierten Medien auch folgenreiche Veränderungen in den Erzählformaten, die wesentlich dazu beigetragen haben, die Ökonomie und Ästhetik der veröffentlichten Bildgeschichten neu auszurichten. In den 1920er Jahren kristallisierte sich etwa in vielen Bilderzeitungen die Fotoreportage als neues narratives Format heraus, das u.a. auch für die Bild-Text-Berichte über Rom*nja und Sinti*zze häufig verwendet wurde. Während in den frühen 1920er Jahren viele illustrierte Zeitungen zunächst noch vorwiegend textlich kommentierte Einzelfotos veröffentlichten, setzten sich in manchen Bildjournalen ab Mitte der 1920er Jahre immer öfter längere, teilweise komplex gebaute Bild-Text-Geschichten durch, „fotografische Reisereportagen“ und „Fotoreportagen“. Diese Bild-Text-Geschichten, zu denen auch zahlreiche „Roma-Reportagen“ gehören, wurden im Layout grafisch und typografisch teils sehr eng miteinander verzahnt, textlich kommentiert und je nach redaktioneller Ausrichtung der Zeitung und je nach Blickwinkel und Perspektive zu sehr unterschiedlichen Bildnarrativen verdichtet.
Ab Ende der 1930er Jahre bereitete die nationalsozialistische Verfolgung, die in der vorliegenden Studie nicht im Zentrum steht,[4] und der beginnende Krieg der großen öffentlichen Präsenz der Rom*nja und Sinti*zze ein Ende. Nach dem Zweiten Weltkrieg gerieten die zahlreichen fotografischen Berichte der Vorkriegszeit weitgehend in Vergessenheit, ein Großteil der originalen Fotoabzüge und Negative, die als Vorlage für die Zeitungsveröffentlichungen gedient hatten, ging verloren. Erhalten haben sich aber in den Bibliotheken und Zeitungssammlungen die gedruckten Reportagen. Dieses bisher in der Forschung zur visuellen Darstellung der Rom*nja und Sinti*zze noch wenig beachtete Quellenmaterial wird im Projekt länderübergreifend untersucht.
Das Forschungsprojekt beschäftigt sich am Beispiel der in Massenmedien veröffentlichten Bilder und Texte mit zentralen Fragen der historischen und gegenwärtigen europäischen Kultur: Wie werden kulturelle, soziale und ethnische Grenzziehungen gezogen und wie werden sie visuell dargestellt? Wer bestimmt in Bildern, Texten und medialen Diskursen darüber, wo und wie die Grenzen zwischen dem (behaupteten) „Eigenen“ und dem (vorgestellten) „Fremden“ gezogen werden? Das untersuchte Bildmaterial ist aber auch noch aus einem anderen Grund bedeutsam: Oft stellen die Fotografien, die in der Zwischenkriegszeit in Zeitungen und Magazinen veröffentlicht wurden, zeitlich gesehen die ersten fotografischen Dokumente dar, die an manchen Orten von Rom*nja und Sinti*zze überliefert sind. Diese Bilder können, obschon meist von außen und häufig unter einem stereotypisierenden Blickwinkel aufgenommen, als wichtige Bausteine für eine neue familiäre und kollektive Erinnerungskultur innerhalb und außerhalb der Rom*nja und Sinti*zze-Communities Verwendung finden.
Fotografische Konstruktionen zwischen Faszination und Ausgrenzung
Die fotografische Darstellung und Dokumentation der Rom*nja und Sinti*zze reicht bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts zurück.[5] Zahlreiche der in der Fotografie oft wiederkehrenden Motive und Bildmuster weisen eine lange Vorgeschichte in (literarischen ebenso wie in nichtliterarischen) Texten auf.[6] Die fotografischen Images wurden darüber hinaus in hohem Maße von der Druckgrafik geprägt, die das Bild der Minderheit vor allem im 18. und 19. Jahrhundert formte. Eine ganze Reihe dieser textlichen und bildlichen Motive und Muster wurden in der zweiten Hälfte des 19. und endgültig im 20. Jahrhundert von der Fotografie übernommen, weiterentwickelt und umgeformt.[7] Aber diese fotografischen Bilder erlebten bis zum Aufkommen der visuellen Massenvervielfältigung von Fotografien in der illustrierten Presse um 1900 keine große Verbreitung.[8] Das änderte sich in den Jahren nach 1900 grundlegend, als sich die illustrierte Presse allmählich zur neuen Leitkultur in der massenmedialen Bildberichterstattung entwickelte. In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg verstärkte sich diese Entwicklung noch einmal deutlich, die Illustrierten erlebten in zahlreichen Ländern Europas enorme Auflagenzuwächse[9] und stiegen – neben dem Film – zum reichweitenstärksten visuellen Massenmedium auf.[10]Diese Rolle behielten die Bilderzeitungen bis in 1950er, 1960er und zum Teil noch bis in die 1970er Jahre, als ihnen in Form des Fernsehens ein neues, reichweitenstarkes visuelles Konkurrenzmedium erwuchs.[11]
Die fotografischen Darstellungen der Rom*nja und Sinti*zze pendelten in den Zeitungen und Zeitschriften zwischen visuellen Strategien der kulturellen, sozialen und rassistischen Ab- und Ausgrenzung und stereotypen Formen der Idealisierung, etwa in Form des Topos eines angeblichen „freien“ und „nomadischen Lebens“, wobei nicht selten beide Bildstrategien eng miteinander verschränkt waren. Hin und wieder entstanden jedoch auch weitgehend unvoreingenommene fotografische Dokumente – wie im Fall der ungarischen Fotografin Kata Kálmán, die die tief verwurzelten hierarchischen Sichtweisen in Frage stellten. Parallel zu den zahlenmäßig häufig verwendeten stereotypen Bildentwürfen in den Mainstream-Medien entstanden im Zuge der zivilen Emanzipationsbewegungen der Minderheit in einigen Ländern Südosteuropas auch Roma-eigene Zeitschriften, die andere, selbstbewusstere Bilder der Minderheit entwarfen, die im Projekt ebenfalls untersucht und mit den Mainstream-Inszenierungen in Verbindung gesetzt werden sollen.[12] Untersucht wird unter anderem, ob und inwiefern sich die stereotypen und hierarchischen Repräsentationen von den Selbstdarstellungen der Minderheit unterscheiden. Gab es Möglichkeiten, den hegemonialen und hierarchischen Bildern alternative Darstellungsformen entgegenzusetzen?
Hierarchien des Sehens – Bilder und Gegenbilder
Die Geschichte der fotografischen Darstellungen von Rom*nja und Sinti*zze ist geprägt von der extremen gesellschaftlichen Ungleichheit zwischen jenen, die vor der Kamera standen, und jenen, die den Apparat bedienten und die Bilder für die Medien aufbereiteten.[13] Besonders deutlich wird dieses Ungleichgewicht dann, wenn man bedenkt, dass bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts die überwiegende Mehrheit der Fotografien von Rom*nja und Sinti*zze von Fotograf*innen aufgenommen wurden, die nicht der Gruppe der Porträtierten angehörten. Während die Fotograf*innen in vielen (aber nicht in allen Fällen) bekannt sind, weil ihre Namen in der Presse genannt wurde, gilt das für die Porträtierten nur in den seltensten Fällen. Rom*nja und Sinti*zze wurden in den allermeisten Fällen anonym, das heißt ohne Namensnennung, porträtiert. Bemerkenswert ist weiters, dass viele der in den Medien veröffentlichten Bilder im Freien aufgenommen wurden, um die nicht-sesshafte, „nomadische“ Kultur besonders zu betonen.[14] Häufig sind die Fotografierten zudem in Gruppen und nicht als Einzelpersonen abgebildet.[15]
All diese Formen der sozialen und visuellen Hierarchisierung, die noch genauer ausgeführt werden müssten, setzten sich auch im Bereich der Bildverarbeitung sowie im Publikations- und Rezeptionsprozess der Bilder fort. Die in den Bildberichten und Reportagen abgebildeten Personen, die Mitglieder der Rom*nja und Sinti*zze, gehörten in den allermeisten Fällen nicht zur Gruppe der Medienleute, die diese Bilder für den Druck aufbereiteten, vervielfältigten, kommentierten und mit Texten anreicherten bzw. umgaben. Und auch die große Gruppe der Leser*innenschaft war im Falle der (Mainstream-)Zeitungsberichte nicht identisch mit der Gruppe der Porträtierten. Obwohl also die Hierarchie der Blickachsen zwischen den Fotograf*innen und den Dargestellten unverrückbar erscheint und die sozialen, politischen und medialen Gebrauchsweisen der Fotografie die Porträtierten von einer Mitwirkung im Prozess der Veröffentlichung weitgehend ausschlossen, wäre es dennoch zu kurz gegriffen, die Bildwelt der Rom*nja und Sinti*zzeausschließlich unter dem Gesichtspunkt der passiven Opferrolle und des gesellschaftlichen und visuellen Ausschlusses zu interpretieren.
Ein zentrales Anliegen des Projekts liegt darin, die Hierarchien des Sehens auf unterschiedlichsten Ebenen zu beschreiben, zu hinterfragen und die – wenn auch geringen – Freiräume im Prozess des Bildermachens beispielhaft sichtbar zu machen. Untersuchungen von Eve Rosenhaft haben etwa gezeigt, dass die herkömmlichen Konzepte der Handlungsmacht (agency)[16] in fotografischen Dispositiven bzw. im Umgang mit Fotografien und die strikte Trennung zwischen (aktiven) Fotografierenden und (passiven) Fotografierten in Bezug auf die fotografischen Inszenierungen der Rom*nja und Sinti*zze differenziert betrachtet werden müssen.[17] Auch Elizabeth Edwards hat darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, Fotografien als „Knotenpunkte historischer Erfahrung“ (Edwards) zu sehen, in die sowohl die Erfahrungen der Fotograf*innen, die politisch-gesellschaftlichen Erfahrungshintergründe einer Epoche, aber, nicht zu vergessen, nicht minder auch jene der Porträtierten selbst eingeschrieben sind.[18] Die in den Fotos Dargestellten sind, so Edwards, insbesondere im Falle kolonialer Bildprojekte (zu denen im weitesten Sinne auch viele Fotoprojekte über Rom*nja und Sinti*zze zu zählen sind) hierarchischen visuellen Verhältnissen unterworfen. Aber sie gehen in dieser eindimensional unterordnenden Rolle nicht gänzlich auf. Die ursprünglich hierarchischen Inszenierungen können im Tableaux der fotografischen Bilder, aber auch in ihrem späteren gesellschaftlichen Gebrauch, ein unkontrollierbares Eigenlegen entwickeln und einen Überschuss an Bedeutungen annehmen, die sich von der Schwerkraft des politisch-gesellschaftlichen Kontextes nicht bändigen lassen.[19]
Einen ähnlichen Gedanken formuliert auch Ariella Azoulay in ihrem Buch The civil contract of Photography.[20] Die Porträtierten, betont sie, gehen im identifizierenden und hierarchisierenden Blick der Kamera und der Betrachter nie zur Gänze auf, sie können sich auch in subalternen fotografischen Rollen dem mächtigen taxierenden ein stückweit entziehen. Die kritische Lektüre der Fotografie hat also durchaus Möglichkeiten, das Korsett vordefinierter Blickmuster zu hinterfragen und für manche Bilder und ihren gesellschaftlichen Gebrauch alternative Interpretationen zu eröffnen.[21] Zwar waren die Angehörigen der Minderheit der Rom*nja und Sinti*zze in sehr vielen der untersuchten Bilder auf die stereotypen Rollen der „Fremden“, „Anderen“, „Ausgegrenzten“ festgeschrieben, sie konnten das Machtgefälle des Sehens nicht grundlegend in Frage stellen. Und dennoch: Bei genauerer Analyse des Bild- und Medienmaterials lässt sich feststellen, dass es zahlreiche Beispiele für aktives Agieren der Porträtierten auf der Bühne der Fotografie gibt. In den untersuchten Bildberichten begegnen uns nicht nur passive Haltungen der Dargestellten, sondern nicht selten auch agierende, performative, gewitzt auf die Situation antwortende, ja gelegentlich sogar widerständige Haltungen und Posen. Dazu kommen hin und wieder auch Körperhaltungen, etwa im Bereich des Tanzes, die die Anwesenheit und die machtvolle Präsenz des Fotografen weitgehend ignorieren. All diese dem Mainstream des Sehens gegenläufigen, gelegentlich auch ironisch-subversiven, Blick- und Körperregimes sind einer genaueren Betrachtung wert, denn sie enthalten wichtige Hinweise darauf, wie die schematische und allzu dichotomisch konzipierte Gegenüberstellung der aktiv Fotografierenden und der passiv der Kamera Ausgelieferten hinterfragt werden kann. Eine Reihe von Bildbeispielen, die im Projekt genauer untersucht werden sollen, deutet darauf hin, dass viele Aufnahmesituationen überaus theatral anmutende und inszenierende Aufführungen waren, bei denen die Porträtierten sehr wohl – oft vermutlich auch gegen die Intention der Fotograf*innen – selbstbewusste Rollen einnahmen.
Das betrifft etwa mehr oder weniger aktive Interventionen der Dargestellten in die die Szenografie der Darstellung, performative Darbietungen vor der Kamera, unerwartete Augenkontakte zu den Fotografierenden oder eigenmächtige Posen.[22] Der burgenländische Romajunge, der 1932 auf dem Titelblatt der Wiener Illustrierten Jedermann dargestellt ist, weist zum einen viele der stereotypen Zuschreibungen, die in der Darstellung der Rom*nja und Sinti*zze dieser Jahre weit verbreitet waren, auf. Seine Kleidung ist ärmlich und zerschlissen, er tritt, wie viele andere seiner Gemeinschaft, im Freien vor die Kamera. Aber der selbstbewusst lächelnde Blick des Jungen und seine eigenwillige (grüßende?) Geste mit der Hand signalisieren, dass es neben diesen überkommenen Bildmustern, die immer wieder wiederholt werden, auch andere, oft ungewohnte Elemente in dieser Darstellung gibt, die in Kontrast zur stereotypen Aufnahmesituation stehen. Dazu gehört die aktive Kontaktaufnahme des Porträtierten mit der Kamera, mit den Leser*innen der Zeitung, und letztlich aber auch mit uns, die wir dieses Bild viele Jahrzehnte später aus einem anderen Blickwinkel betrachten können. Dieses Beispiel zeigt, dass die Rolle und Mitwirkung der Porträtierten oft weit komplexer ist als auf den ersten Blick angenommen. Fototermine wurden von den Dargestellten offenbar immer wieder als Pflichtübungen unter Zwang wahrgenommen. Dokumentiert sind neben aktiven Blickkontakten auch Blickverweigerungen und vereinzelt auch Beispiele regelrechter Bildverweigerung vor der Kamera. Vereinzelt flüchteten die für die Darstellung ausgewählten Personen vor dem/der Fotograf*in oder verweigerten die Abbildung. Immer wieder lassen sich auch selbstbewusste Formen der „Monetarisierung“ der „Aufführungen“ vor der Kamera nachweisen. Es gibt Berichte, wonach Rom*nja und Sinti*zze manchmal für „Fotositzungen“ oder für bestimmte, von den Fotograf*innen gewünschte, Haltungen und Posen Geld oder auch Naturalien verlangten bzw. bekamen. Gelegentlich wurden die vor der Kamera widerwillig agierenden Mitglieder von Roma-Gemeinschaften sogar mit Alkohol für die Aufnahme gefügig gemacht. All diese Formen von impliziter und expliziter Resistenz und des fotografischen „Tauschhandels“ sind in der Fotoforschung bisher kaum untersucht worden. Sie sollen im Projekt anhand konkreter Beispiele näher analysiert werden.
Die Konstruktion von Medienbildern
Die in den Medien veröffentlichten Bildberichte und Fotoreprotagen über Rom*nja und Sinti*zze erreichten in der Zwischenkriegszeit ein Massenpublikum. Das zentrale Quellenmaterial der Untersuchung bilden gedruckte Bildberichte in europäischen Wochenzeitungen sowie in periodisch erscheinenden Zeitschriften und Magazinen.[23]Analysiert werden ausgewählte überregional erscheinende illustrierte Wochenzeitungen aus mehreren europäischen Ländern, beispielhaft werden aber auch kleinere regionale Zeitschriften und Magazine sowie illustrierte Wochenendbeilagen von Tageszeitungen in die Analyse miteinbezogen. Berücksichtigung finden auch ausgewählte illustrierte Parteizeitungen oder parteinahe Journale, punktuell auch konfessionelle Zeitungen. Dabei wird geprüft, ob und inwieweit die ideologische, politische und konfessionelle Ausrichtung der Zeitungen und Magazine und ihre je unterschiedliche Leser*innenschaft Einfluss auf die Bildentwürfe hatte, die von der Minderheit hergestellt und in Umlauf gebracht wurden.
Eine wichtige Rolle in der Konstruktion von Images der Rom*nja und Sinti*zze in der Zwischenkriegszeit spielen, wie bereits angedeutet, Text-Bild-Geschichten, die ab Mitte der 1920er Jahre im Format der „Fotoreportage“ eine Blütezeit erlebten. Das Genre der Reportage, die im späten 19. Jahrhundert als hybrides Genre zwischen journalistischer Berichterstattung und Imagination entstanden war,[24] wurde im frühen 20. Jahrhundert medial erweitert und ausgebaut.[25] In den Jahren um 1930 erlebte insbesondere die Fotoreportage eine Blütezeit. In diesem Format wurden neue Erzählstrategien, die Texte, Bilder, Grafiken bzw. gelegentlich Zeichnungen sowie die typografische Gestaltung auf neue Weise verschränkten, erprobt.[26] Sowohl die bürgerliche Mainstream-Presse als auch linke Oppositionsmedien entwickelten dieses neue Medienformat weiter.[27] Mediengeschichtlich knüpften manche Fotoreportagen aus der Zwischenkriegszeit an populäre, oft auch populärwissenschaftliche „soziographische“ Erkundungen der sozialen und kulturellen Ränder der bürgerlichen bzw. kleinbürgerlichen Welt an, wie sie im 19. Jahrhundert weit verbreitet waren.[28] Im (druck-)grafischen ebenso wie im literarischen Bereich war schon früh ein umfangreicher populärkultureller Fundus an Bildern entstanden, der den Blick auf ethnisch markierte Gruppen, Minderheiten und Außenseiter visuell entscheidend geprägt hat.[29] Die im 18. und 19. Jahrhundert entwickelten Bildformeln des Exotischen[30] wurden – etwa in der Inszenierung sogenannter ethnischer Typologien[31], aber auch von Geschlechterrollen[32] – in der Fotografie aufgegriffen, verdichtet und umgeformt. Dabei tauchen einzelne Fotografien immer wieder und in teils sehr unterschiedlichen Kontexten, aber auch in unterschiedlichen Medien und Ländern auf, wobei sich visuelle Einbettung, Betextung und die dadurch hergestellte Bedeutung der Bilder von einer Veröffentlichung zur nächsten erheblich verändern können.
Viele Fotoreportagen und Bildberichte über Rom*nja und Sinti*zze aus der Zwischenkriegszeit weisen, bei aller Unterschiedlichkeit in Struktur und z.T. auch in der Motivik, Parallelen zu visuellen Erkundungen in außereuropäische und koloniale Welten auf.[33] Dabei fungiert die Fotografie in den populären Bildmassenmedien, wie Ariella Azulay ausgeführt hat, u.a. als eine Art Spiel- und Echoraum bürgerlicher Wünsche und Sehnsüchte.[34] In einer historischen Phase, in der das bürgerliche Selbstverständnis und Selbstbewusstsein brüchig geworden war, boten die Illustrierten den lesenden und schauenden „Armchair-Tavellern“ in fotografischen Geschichten immer wieder Ausflüge in fremde, faszinierende Welten an, deren Verlockungen und Bedrohungen im Dialog zwischen Bild und Text aufbereitet wurden.[35] Genau diese Überlagerung von bürgerlicher Selbstwahrnehmung und Projektionen des Fremden findet sich häufig in den Bildern und Texten der im Projekt untersuchten Bildberichte und Reportagen über Rom*nja und Sinti*zze.
Ein neuer Blick auf die Repräsentationsgeschichte der Rom*nja und Sinti*zze
Der massenmediale „Hype“ der 1920er und 30er Jahre war von einer beispiellosen „visuellen Neugier“ der Mainstream-Medien gegenüber der marginalisierten Gruppe geprägt, die als exotisch, sozial und kulturell „fremd“, „minderwertig“ oder auch „gefährlich“ dargestellt wurde. Diese in großer Zahl und in hohen Auflagen verbreiteten Bilder haben bis heute ihre Spuren in der kollektiven Wahrnehmung hinterlassen.[36] Weit verbreitete fotografische Darstellungen der Rom*nja und Sinti*zze rekurrieren im Kern immer noch auf Bildmuster und Darstellungskonventionen, die in den frühen Bildmassenmedien veröffentlicht wurden. Aus diesem Grund gibt die Analyse des historischen Materials auch Aufschluss über Bildformeln, die eine enorme Langzeitwirkung entfaltet haben. Zu fragen ist in der Untersuchung über die Darstellungs- und Inszenierungsstrategien der Rom*nja und Sinti*zze in der Zwischenkriegszeit insbesondere, ob und inwieweit sich in unterschiedlichen Zeitungen und Magazinen, gesellschaftlichen Kontexten, Regionen und Anlässen bestimmte Muster, aber auch Unterschiede diagnostizieren lassen. Zu untersuchen ist ferner, wo es signifikante Abweichungen von den hegemonialen Bildmustern gibt und in welchem Ausmaß sich in manchen Medien bzw. in manchen Reportagen neben den vorherrschenden stereotypisierenden auch andere, gegenläufige, selbstreflexive und eventuell auch widerständig-subversive Bildstrategien finden lassen.
Das Forschungsprojekt eröffnet am Beispiel der Medienkultur der Zwischenkriegszeit einen neuen, differenzierten Blick auf die Repräsentationsgeschichte der Rom*nja und Sinti*zze im 20. Jahrhundert. Der Fokus der Analyse liegt zeitlich gesehen vor der systematischen Verfolgung, Entrechtung und Vernichtung der Roma-Gemeinschaften durch den Nationalsozialismus und andere diktatorische und autoritäre Regimes.[37] Diese Jahre der Verfolgung in der NS-Zeit haben die Geschichte der Minderheit im 20. Jahrhundert entscheidend geprägt. Aber erstaunlicherweise haben diese leidvollen Erfahrungen die vorherrschenden Nachkriegs-Images der Rom*nja und Sinti*zze in der Öffentlichkeit nach 1945 weit weniger geprägt als vielleicht zu erwarten gewesen wäre.[38] Denn die Gewalttaten an der Minderheit wurden erst relativ spät öffentlich anerkannt und die Geschichte der Verfolgung erst mit großer Verspätung und oft nur halbherzig historisch aufgearbeitet. Möglicherweise ist das mit ein Grund dafür, dass in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg in Fotobüchern, Zeitschriften und auch im Film in großem Maße Bildmuster recycelt wurden, die in den 1920er und 30er Jahre massenwirksam in der illustrierten Presse verbreitet worden waren.
Die untersuchten Bilder und Texte werden im vorliegenden Projekt dezidiert nicht als Dokumente der Vorgeschichte der nationalsozialistischen und rassistischen Verfolgung der Roma-Gemeinschaften in vielen europäischen Ländern interpretiert. Das würde ihre Bedeutung und Reichweite zu sehr einengen. Vielmehr bieten die in den Zeitungen und Zeitschriften verbreiteten Bildberichte Ansatzpunkte und wichtiges Quellenmaterial für eine Langzeitanalyse jener Wahrnehmungsmuster, die das Bild der Minderheit bis heute – und auch über die einschneidende Zeit des Holocaust und seiner Folgen hinweg – geprägt haben.
-------------------------
[1] Bemerkungen zur Terminologie: Der Begriff „Sinti“ wird in der Regel für die in Mitteleuropa seit dem ausgehenden Mittelalter beheimateten Angehörigen der Minderheit verwendet, während der Begriff „Roma“ meist die Mitglieder ost- bzw. süd-osteuropäischer Herkunft bezeichnet. Die nationalen Rom*nja und Sinti*zze-Gemeinschaften sind durch die Geschichte und Kultur ihrer jeweiligen Heimatländer stark geprägt. Beide Begriffe tauchen in historischen Quellen bereits seit dem 18. Jahrhundert auf. Der Begriff „Zigeuner“ (ebenso wie nichtdeutschsprachige Entsprechungen wie cikáni, cigány, ţigan usw., fungierte im Zeitraum der Untersuchung (und auch danach) fast durchgängig als abwertende, diskriminierende, ausschließende, im zeitgenössischen Kontext gelegentlich aber auch positiv stereotypisierende Fremdbezeichnung (exonyme Bezeichnung). Ähnliches gilt, mit Einschränkungen, für den Begriff „Gypsy“, dessen historischer und aktueller Gebrauch ambivalenter ist. Vgl. dazu etwa Paloma Gay y Blasco: Picturing „Gysies“. Interdisciplinary Approaches to Roma Representation, in: Paloma Gay y Blasco, Dina Jordanova (Hg.): Picturing Gypsies: Interdisciplinary approaches to Roma Representation, Third Text-Critical Perspectives on contemporary art and culture, Vol. 22, (special) issue 3, Abingdon: Francis & Taylor, 2008, S. 297–303. Diskriminierende Begriffe, die aus zeitgenössischen Quellen stammen, werden in Anführungszeichen zitiert und wo nötig kommentiert. Ausführlicher zur Terminologie, ihrer historischen und aktuellen Bedeutung sowie ethischen Richtlinien der Sprache siehe: RomArchive. Digitales Archiv der Sinti und Roma: www.romarchive.eu/glossar
[2] Sabrina Kopf: Roma and Sinti: The ‘Other’ within Europe, in Ulrich Kockel, Máiréad Nic Craith, Jonas Frykman (Hg.): A Companion to the Anthropology of Europe, Oxford: Wiley Blackwell, 2012, S. 310–21.
[3] Vgl. ausführlicher Anton Holzer: ‚Zigeuner‘ sehen. Fotografische Expeditionen am Rande Europas, in: Herbert Uerlings, Iulia-Karin Patrut (Hg.): ‚Zigeuner‘ und Nation. Repräsentation – Inklusion – Exklusion, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2008, S. 401–420; Anton Holzer: Bilder im Kopf. Die „Roma-Schule“ in Užhorod. Fotografische Konstruktionen des Fremden, in: Fotogeschichte. Beiträge zur Geschichte und Ästhetik der Fotografie, Heft 175, 2024, S. 18–23.
[4] Vgl. dazu ausführlicher u.a. María Sierra: The Roma and the Holocaust. The Romani Genocide under Nazism, London: Bloomsbury, 2024; Anton Weiss-Wendt (Hg): The Nazi Genozide of the Roma. Reassessment and Commemoration, New York, Oxford: Berghahn, 2013; Guenter Lewy: The Nazi Persecution of the Gypsies, Oxford: Oxford University Press, 2001; Karola Fings: „Restlose Abschaffung der Zigeuner.“ Der Völkermord an den Sinti und Roma im Nationalsozialismus, in: Winfried Nerdinger (Hg): Die Verfolgung der Sinti und Roma in München und Bayern 1933–1945, Berlin: Metropol 2016, S. 104–113.
[5] Zu den frühesten fotografischen Roma-Darstellungen aus den 1850er Jahren siehe Anton Holzer: In the Shadow of the Crimean War. Ludwig Angerer‘s photographic expedition to Bucharest (1854 to 1856) in: Peter Pakesch, Verena Formanek (Hg.): Seeing Carmen. Goya. Courbet. Manet. Nadar. Picasso, Köln: Walther König, 2005, S. 284–337.
[6] Vgl. etwa Deborah Epstein Nord: Gypsies and the British Imagination 1807–1930, New York: Columbia University Press, 2006; Klaus-Michael Bogdal, Europe and the Roma: A History of Fascination and Fear (London: Allan Lane, 2023, Erstausgabe: Berlin: Suhrkamp, 2011); Hans Richard Brittnacher: Leben auf der Grenze: Klischee und Faszination des Zigeunerbildes in Literatur und Kunst, Göttingen: Wallstein, 2012.
[7] Für einen breiten Überblick über die Roma-Fotografie im 19. und 20. Jahrhundert siehe Frank Reuter: Der Bann des Fremden: Die fotografische Konstruktion des “Zigeuners”, Göttingen: Wallstein, 2014.
[8] Vgl. etwa Ilsen About, Mathieu Pernot, Adèle Sutre: Mondes Tsiganes: La Fabrique des images. Un histoire photographique 1860–1980, Arles: Actes Sud, 2018; Paloma Gay & Basco, Dina Iordanova (Hg.): Picturing „Gypsies“, (Anm. 1); Jodie Matthews: The Gypsy Woman. Representations in Literature and Visual Culture, London: I.B. Tauris/Bloomsbury, 2018.
[9] Vgl. Mats Jönsson, Louise Wolthers, Niclas Östlind (Hg.): Thresholds. Interwar Lens Media Cultures 1919–1939, Köln: Walther König 2021.
[10] Vgl. Tim Satterthwaite, Andrew Thacker (Hg.): Magazines and Modern Identities. Global Cultures of the Illustrated Press, 1880–1945, London: Bloomsbury, 2023; Sarah Newman, Matt Houlbrooke: The Press and Popular Culture in Interwar Europe, London: Routledge, 2014.
[11] Jason E. Hill, Vanessa R. Schwartz (Hg.): Getting the Picture. The Visual Culture of the News, London and New York: Bloomsbury, 2015.
[12] Siehe dazu die Forschungsarbeiten und Veröffentlichungen von Elena Mariushiakova, Vesselin Popov